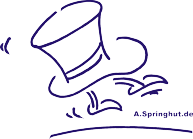WArum der Verlorene Sohn kein Prasser sein musste
[ Diesen Beitrag als PDF und mit Fußnoten lesen ]
Im Gleichnis vom Verlorenen Sohn, so wie es die Lutherbibel scheint alles wohl sortiert zu sein: Auf der einen Seite ein liebender Vater, der seinen Sohn ziehen lässt und ihn sehnsüchtig wieder erwartet. Auf der anderen Seite ein verlorener Sohn, der sein Erbe mit Huren verprasst. Dann noch ein scheinbar anständiger Sohn, der ehrbar und rechtschaffen für seinen Vater arbeitet.
Dass es nicht um einen, sondern um zwei verlorene Söhne geht, gehört mittlerweile zum Allgemeingut: Der scheinbar gute Sohn zu Hause ist doch voller Bitterkeit und Distanz zum Vater. Aber auch das Bild vom liebenden Vater bekommt Risse, wenn ich mir das Gleichnis und seinen Zusammenhang ansehe: Das Schaf wird gesucht. Die Münze wird gesucht. Aber der Sohn wird nicht gesucht. Ist das ein liebender Vater?
Bleibt noch der jüngere Sohn, der offensichtlich Verlorene. Der Prasser, so wie ihn sein Bruder bezeichnet. Aber woher weiß er das, was sein Bruder in einem fernen Land gemacht hat?1 Ist es nicht die Eifersucht und Missgunst, die seinem Bruder das Schlechteste unterstellt? Und wir? Wir lassen uns von den Worten des Bruders verlocken und wollen glauben, was wir auch nicht wissen können. Es ist der Bruder, der sagt, dass der da sein Erbe mit Huren verprasst hat – und wir deuten die Worte Jesu so, wie wir sie hören wollen: „und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen“. Aber dieses Wort muss nicht unbedingt mit „Prassen“ werden. Sie ergibt sich alleine durch die unterstellte Erzähllogik des Gleichnisses2: „Wenn das Münchener Neue Testament „asōtōs“ mit „liederlich“, dann wertet die Übersetzung eindeutig moralischer als es das Griechische verlangt. ἀσώτως (asōtōs) bringt “weniger die Verachtung gegenüber dem Lebenswandel des Sohnes, als vielmehr die sachliche Kennzeichnung seines Weges als eines “heillosen” zum Ausdruck, als eines Weges, der klar erkennbar wegführt vom Heil.“3 Es bezeichnet den „Charakter eines haltlosen, verlassenen, verkommenen Mannes, der nicht gerettet werden kann.“4
Alles, was wir über den jüngeren Sohn wissen können, ist, dass er in ein fernes Land gezogen ist. Solange er Geld hat, kann er sein Leben in der Fremde finanzieren. In einer Welt, in der jemand als sein Leben lang als Zugezogener gilt, auch wenn er nur aus dem Dorf nebenan kommt oder gar nur aus dem anderen Teil des Dorfes, ist ein Fremder aus der Ferne noch weniger willkommen. Er ist Anfeindungen ausgesetzt und muss sich seinen Schutz erkaufen. Er muss sich alles erkaufen – und bestimmt teurer als die Einheimischen. So verbraucht er sein Erbteil als ein Mensch, der in der Fremde keine Wurzeln schlagen kann und in der Heimat kein Zuhause mehr hat – als ein Mensch, der ganz klar auf dem falschen Weg ist und der so nicht mehr zu retten ist. Alles, was wir darüber hinaus behaupten, ist eine Unterstellung. Wenn wir mehr behaupten wollen, machen wir uns die Worte des missgünstigen, älteren Bruders zu eigen.
Wir stellen uns den Weg des Verlorenen als eine Reise in ein fernes, exotisches Land vor. Aber das Land, in das er zieht, ist gar kein Land. Es ist vielmehr der Raum zwischen zwei Orten5. So wie der erste verlorene Sohn Kain in das Land Nod zieht, in das Land des Wanderns und Herumirrens6, so zieht dieser verlorene Sohn in das Zwischenland, in das Niemandsland. Er zieht von Zuhause fort, aber er kommt niemals an. Vielmehr als dass der Verlorene in ein exotisches Urlaubsland fortzieht, zieht er in die Gottesferne.
Wenn wir dem jüngeren Sohn ein liederliches Leben mit Huren, Drogen und Glücksspiel unterstellen – oder wie wir uns sonst die missgünstigen Worte des älteren Bruders ausmalen, so verengen wir die Bedeutung dieses Gleichnisses.
Wäre der jüngere Sohn ein besserer Mensch gewesen, wenn er sein Hab und Gut nicht versoffen hätte? Hätte es irgendetwas an dem Zustand seines Herzens verändert, wenn er es geschafft hätte, sich in der Fremde eine Existenz aufzubauen? Wären sein Schmerz und seine Wut auf den Vater geringer gewesen, wenn er die richtigen Freunde gefunden hätte, die ihn nicht ausgenutzt haben und ihn in der Hungersnot nicht hätten fallen lassen, sondern ihm geholfen hätten, eine ehrbare Arbeit zu finden und ein eigenständiges Leben aufzubauen?
Ja, wenn wir seine Vergangenheit nicht kennten, dann hätten wir ihn dann vermutlich bewundert: Vielleicht als ein Mensch, der hart arbeitet, um die Anerkennung der Menschen zu finden. Vielleicht als ein Mensch, der immer wieder als wohltätiger Spender auftritt und Almosen gibt, um seine innere Not zu überdecken. Ja, wir hätten uns täuschen lassen von einem Menschen, der nach außen hin ein tadelloses Leben lebt. Die Zerrissenheit und die Not des Jüngeren beginnen nicht in der Hungersnot. Sie beginnen an dem Tag, da er über seinen Vater verbittert, lange bevor er sein Erbe verlangt und vom Vater fortzieht.
Unzählige Menschen leben in einer tiefen Verbitterung gegenüber ihren Vätern. Die großartigsten Menschen sind darunter: Bedeutende Wissenschaftler. Berühmte Sportler. Reiche Menschen. Ehrbare Bürger. Spendable Wohltäter. Aber alles, was sie tun, ist nur ein Schrei nach Anerkennung. Ein Hilferuf nach dem Vater: „Siehst Du mich denn, Vater, endlich!“ Ist ein endloser Kraftakt, es dem Vater zu beweisen, dass sie es doch drauf haben. Aber, was immer sie tun. So sehr sie sich doch anstrengen, nie erreichen sie dieses Ziel. Geraten irgendwann in eine Krise, in eine „Hungersnot“, in der ihr Lebensmuster nicht mehr funktioniert, und zerbrechen daran. So viele Menschen, die nach außen hin Bedeutendes tun und im Inneren einen ungeheuren Schmerz und eine Wut in sich tragen.
Verstehen wir den Vater als ein Symbol für Gott – man muss ihn nicht so verstehen – dann bleibt diese Bedeutung erhalten: Der Mensch – alle Menschen – sind in das ferne Land, in die Gottesferne gezogen, alle Menschen tragen einen tiefen Schmerz und eine Wunde in sich, aber nicht alle äußern das in einem moralisch verwerflichen Leben. Viele gelten zu den Besten und Anständigsten – und sind dennoch fern von Gott – verloren. Deshalb bringt das Wort, das mit „Prassen“ oder „liederlich“ übersetzt wird “weniger die Verachtung gegenüber dem Lebenswandel des Sohnes, als vielmehr die sachliche Kennzeichnung seines Weges als eines “heil-losen” zum Ausdruck, als eines Weges, der klar erkennbar wegführt vom Heil.”7
Jemand könnte einwenden, dass das Leben der „Besten und Anständigsten“ genug durch den älteren, ebenso verlorenen Bruder beschrieben ist, aber ich glaube, dass das noch eine andere Art der Verlorenheit beschreibt, vielleicht eine Verlorenheit trotz eines religiösen Lebens. So wie Paulus drei Typen von Sündern im Römerbrief unterscheidet: den moralisch Verwerflichen, den scheinbar Anständigen und den Religiösen.
[ Diesen Beitrag als PDF und mit Fußnoten lesen ]
photo now (c) flow79 | photocase.de